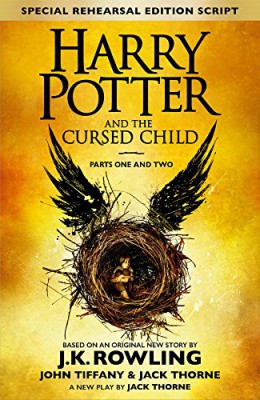Ich habe gerade das Buch von Thomas Lindemann gelesen, in dem er beschreibt, warum er mit Frau und drei Kindern nach Neukölln gezogen ist. Ok, das ist jetzt nicht buchfüllend, es geht auch darum, wie Neukölln war und ist und zu dem geworden ist, was es heute ist. Er beschreibt auch, was schief läuft bei uns, und zwar nicht unbedingt in Neukölln, sondern zum Beispiel am Prenzelberg.
Kurz und viel zu verkürzt zusammengefasst: Wir fordern zwar in allen Bereichen Diversität, aber leben alles andere als divers. Diverse Teams, also nicht nur Männer und Frauen zusammen sondern auch unterschiedliche Kulturen, Hautfarben und Altersstufen sind gut in Unternehmen, Führungspositionen etc. Wer sich nur einmal die Vorstandschefs der Dax30-Unternehmen anschaut, weiß, was ich nicht meine.
In der Kita wird unter Müttern gerne die Nase gerümpft, wenn das eine Kind immer als letztes abgeholt wird. Das können doch keine guten Eltern sein, hört man immer wieder. Lässt man die Kinder zum Geburtstag der älteren Kindergartenfreundin gehen, auch wenn diese dunkle Haut hat? Oder wenn die Eltern bisher nur durch ihr gebrochenes Englisch mit stark russischem Akzentaufgefallen sind? Und warum ist es nicht ok, wenn die Mutter die Tochter lieber noch eine Stunde in der Kita bleibt, um noch im Fitnessstudio zu trainieren?
***
Wir leben nicht divers, sondern umgeben uns immer mehr mit den gleichen Meinungen. Das fängt bei den Twitterblasen jedes Einzelnen an, bei den Facebookblasen. Andersdenkende werden (zu recht und zu unrecht) ausgeschlossen. Dies soll kein Plädoyer dafür sein, sich auf all die Hasskommentare da draußen einzulassen. Aber sich abzuwenden und auf gar keine Diskussion einzulassen? Diskussionen – auch moderiert – nicht mehr zuzulassen? Natürlich kann ich nachvollziehen, dass dabei auch monetäre Gründe eine Rolle spielen. Aber Fakt ist: Kommentarspalten werden geschlossen, „Andersdenkende“ werden bei vielen Nachrichtenseiten ausgeschlossen. Wichtige Diskussionen werden woanders geführt, in Räumen, auf die sich die meisten nicht einlassen. Aus den unterschiedlichsten Gründen, aber auch weil es mühsam ist und weh tun kann. Nicht nur in der Medienlandschaft verebbt der Diskurs.
***
Es langweilt mich wahnsinnig, wenn der Innenminister bei dem ersten Hinweis auf ein Computerspiel reflexartig die Killerspieldebatte belebt. Oder Politiker zu Tatorten oder Orten von Naturkatastrophen reisen, um sich dort publikums- und medienwirksam ein „Bild der Lage“ machen. Oder wenn kurz vor Wahlen reflexartig Versprechungen gemacht werden, bei denen klar ist, dass sie nicht bezahlbar oder politisch nicht durchsetzbar sind. Es führt auch bei mir dazu, dass ich mich in der letzten Zeit immer weniger für das politische Geschehen interessiere. Ich ertrage das oft nicht mehr: diese Sprache, das Taktieren. Es nervt mich, Interviews mit hochrangigen Politikern zu lesen oder zu schauen, was sicherlich auch an den fragenden Journalisten liegen kann, aber ganz sicherlich eher dem Zusammenspiel beider Systeme – Politik und Medienbetrieb geschuldet ist.
In mir keimt Verständnis für all diejenigen auf, die sich abwenden von diesem System, die nach Alternativen suchen. Ich kann nachvollziehen, wie den Brexit-Anhängern der Wahlsieg gelang, warum ein Mann wie Trump möglicherweise der nächste US-Präsident wird, wieso in Europa Kräfte erstarken, die sich gegen all diese politischen Rituale stellen und sich als Alternative präsentieren, auch wenn sie keine echte sind. Sie setzen auf Parolen und Populismus und haben damit Erfolg.
***
Sebastian Matthes schreibt an seinen Sohn Erik, dass dieser einmal im Geschichtsunterricht über das Jahr 2016 reden werde. Und das wir vermutlich kämpfen werden müssen für die Gesellschaft, in der wir groß geworden sind, weil die Ereignisse und Gewalttaten der letzten Wochen und Monate gezeigt haben, dass da gerade etwas kaputt geht. Kämpfen. Was für ein großes Wort, dass er sicherlich mit Bedacht gewählt hat, mit dem ich aber nun schon eine Weile hadere.
***
Nicht nur die Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate haben etwas verändert. Dieser schleichende Prozess bricht nur gerade auf und macht Brüche sichtbar. Und wenn wir all das aufhalten wollen, müssen wir bei uns anfangen. Also ich bei mir, du bei dir und wir bei uns.
Einfach mal mit all denen sprechen, mit denen man nie ein Wort gewechselt hat, dem älteren grimmig dreinschauenden Mann in der Straßenbahn ein paar nette Worte schenken, um ihn zum Lächeln zu bringen. Der aus Syrien zugezogenen Nachbarin mit den drei Kindern einfach mal die Einkaufstasche nach Hause tragen. Sich auf eine nervige Diskussion einlassen, in der Hoffnung überzeugen zu können. Wählen gehen. Politik neu denken und machen. Für neue Werte im Arbeitsleben kämpfen. Diversität leben. Sich trauen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät.
 Das erste Mal in Zürich gewesen und da ist per se ja nicht sofort schön, aber als ich da morgens aus dem Zug stieg und wir in Richtung See liefen und dann sah ich diesen See da vor mir, die Sonne glitzerte auf dem Wasser, Boote bewegten sich sanft mit den Wellen. Ein Mann drehte gerade schwimmend seine Morgenrunde – am liebsten hätte ich mich ebenfalls sofort in die Wellen gestürzt.
Das erste Mal in Zürich gewesen und da ist per se ja nicht sofort schön, aber als ich da morgens aus dem Zug stieg und wir in Richtung See liefen und dann sah ich diesen See da vor mir, die Sonne glitzerte auf dem Wasser, Boote bewegten sich sanft mit den Wellen. Ein Mann drehte gerade schwimmend seine Morgenrunde – am liebsten hätte ich mich ebenfalls sofort in die Wellen gestürzt. Am Abend besuchten wir einen Biergarten. Ich war schon in vielen Biergärten, auch welchen, in denen Live-Musik gereicht wird, aber mit welcher Selbstverständlichkeit hier alle Generationen klassisch tanzten – Foxtrott, Jive, Chachacha – allein oder auch gemeinsam, das war toll und rührte mich. Am zweiten Tag sind wir in den verbliebenen 45 Minuten vor dem Zug zum Flughafen noch einmal hingegangen und wieder: Am hellichten Tag und bei sportlichen Temperaturen wurden die Hüften geschwungen.
Am Abend besuchten wir einen Biergarten. Ich war schon in vielen Biergärten, auch welchen, in denen Live-Musik gereicht wird, aber mit welcher Selbstverständlichkeit hier alle Generationen klassisch tanzten – Foxtrott, Jive, Chachacha – allein oder auch gemeinsam, das war toll und rührte mich. Am zweiten Tag sind wir in den verbliebenen 45 Minuten vor dem Zug zum Flughafen noch einmal hingegangen und wieder: Am hellichten Tag und bei sportlichen Temperaturen wurden die Hüften geschwungen. Gipfeli gegessen. Und Eis aus der Tüte. Für 3,50 Franken. Beinahe hätte ich Hörnchen gesagt.
Gipfeli gegessen. Und Eis aus der Tüte. Für 3,50 Franken. Beinahe hätte ich Hörnchen gesagt.