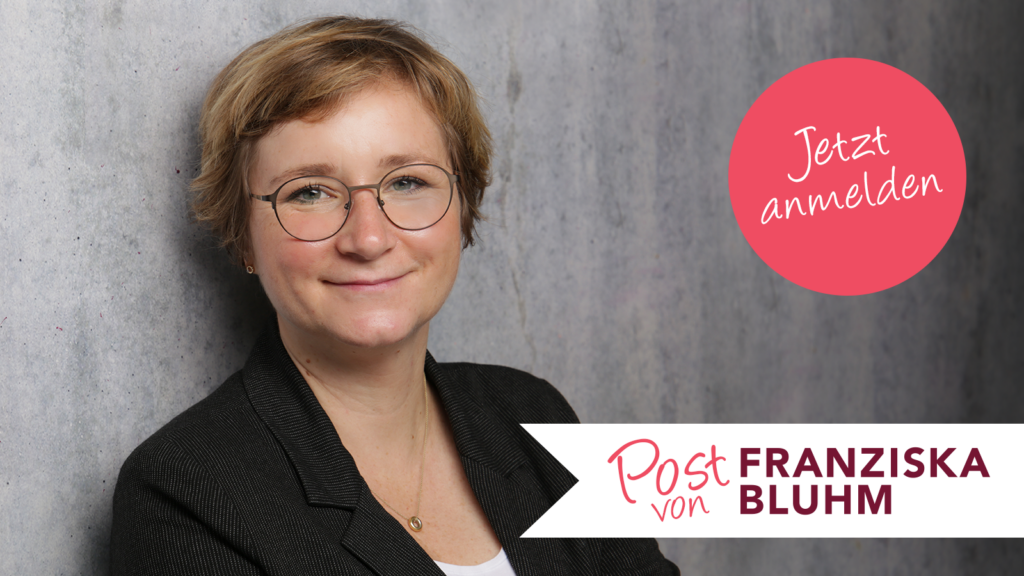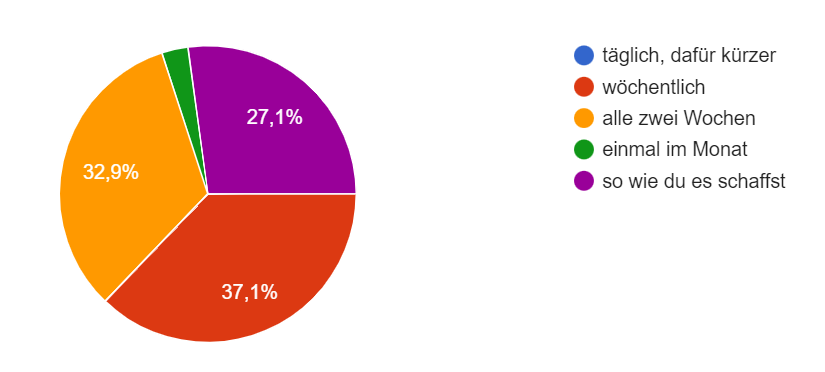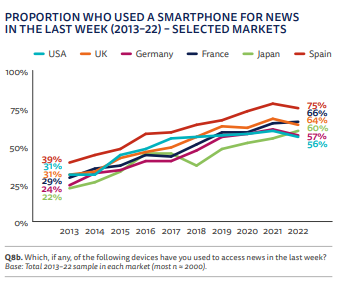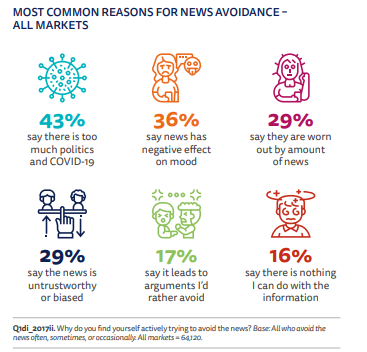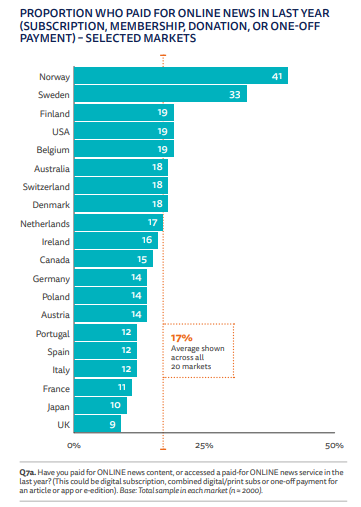Mastodon oder Twitter oder müssen wir uns gar nicht entscheiden?
Mittwochmittag kam der erste Anruf: „Wir verlieren Follower. Meinst du, das liegt an Elon Musk?“ Offenbar gibt es auch in deutschen Kommunikationsteams durch den Einstieg von Elon Musk bei Twitter Gesprächsbedarf. Sind die jetzt alle auf Mastodon? Müssen wir da jetzt auch hin? Und wie erreichen wir eigentlich in Zukunft unsere Zielgruppe, die wir jetzt ziemlich gut über Twitter bedienen? All diese Fragen haben wir andiskutiert. Damit du auch etwas davon hast: der Reihe nach.
Gehen jetzt alle zu Mastodon? Erste Antwort: nein. Zweite Antwort: Glaubt man dem Mastadonusercount-Account dann haben sich gerade einmal 200.000 Menschen in der vergangenen Woche bei Mastodon angemeldet. Das ist wenig. Insgesamt gibt es jetzt knapp 6 Millionen Mastodon-Nutzende im Vergleich zu 211 Millionen bei Twitter.
Vermutlich gibt es andere Gründe für den Follower-Rückgang. Sollte sich der eine oder andere im Zuge des Musk-Deals bei Twitter abgemeldet haben, heißt das noch lange nicht, dass diese Menschen dann auch zu Mastodon gehen. Vielleicht geben sie ja sogar Facebook wieder eine Chance?
Muss ich jetzt auch zu Mastodon? Müssen ist ja ein sehr großes Wort. Wenn du dich dafür interessierst, welches soziale Netzwerk sogar die obersten Datenschützer Deutschlands cool finden, dann meld dich an. Soll aber auch Leute geben, die genau das abschreckt. Meine Haltung hier ist: Es schadet nie, sich mit neuen Netzwerken zu befassen, herauszufinden, was auf diesen gut funktioniert. Ob Menschen es aktiv nutzen und ob eine relevant hohe Zahl an Menschen hier mittelfristig eine Alternative findet, die die eigenen Bedürfnisse befriedigt.
Was kann Mastodon? Tweets heißen dort Tröts und können 500 Zeichen umfassen. Die Usability ist bisher anstrengend. Mastodon besteht aus einem dezentralen Netzwerk von verschiedenen Servern, sogenannten „Instanzen“. Diese werden von Privatpersonen oder Gemeinschaften betrieben, derzeit gibt es knapp 4000 davon. Fun Fact: Die Bestätigungsmail zur Aktivierung meines Accounts benötigte drei Tage bis zum Eingang in meinem Postfach. Das ist sehr lang.
Kann ich noch bei Twitter bleiben? Dagegen spricht aus meiner Sicht erstmal nichts. Fakt ist aber: Twitter wird sich verändern. Eine von Musks ersten Amtshandlungen war, große Teile der Führungsriege auszutauschen. Weitere werden vermutlich folgen. Im ausgeloggten Zustand bekommt man auf Twitter.com nun Trending Topics ausgespielt. Das kostenpflichtige Produkt „Twitter Blue“ soll offenbar so schnell wie möglich an den Start gehen. All das kann Schlechtes bedeuten, aber vielleicht auch nicht. Fakt ist: Twitter hat seit Jahren zahlreiche Probleme nicht in den Griff bekommen, zum Beispiel das Thema „Content-Moderation“ (sehr lesenswert dazu). Ich würde abwarten, bis die ersten Veränderungen wirklich sichtbar werden. Und das kann auch bedeuten, Werbekampagnen erstmal zu pausieren.
Am Ende ist es natürlich eine strategische Entscheidung: Kann ich es für mein Unternehmen oder mich vertreten, auf der Plattform unterwegs zu sein? Kann ich dort meine Ziele und Zielgruppe erreichen oder gibt es andere Möglichkeiten? Kann ich auf anderen Wegen genauso gut Teil des gesellschaftspolitischen Diskurses sein?
Dieser Text ist zuerst in meinem wöchentlichen Newsletter erschienen. Hier kannst du ihn abonnieren.